
Ich setze mich auf einen der Stühle. Gabriela wischt noch einmal mit einem nassen Lappen über das grün-rot karierte Wachstischtuch. Gabrielas Fischstube im alten Fischerviertel Kaneo habe ich also gefunden. Gar nicht so einfach. Nicht aber wegen der Sprache, sondern weil sich an diesem ungemütlichen Nachmittag einfach niemand auf den Strassen aufhielt, den ich nach dem Weg hätte fragen können.
Immer wieder trottete ich die kleinen Gassen auf und ab, bis endlich eine ganz in schwarz gekleidete Frau um die Hausecke biegt. Auch sie hat keine Ahnung, aber treibt mich unbeirrt in eines der Fischrestaurants, fragt den Kellner nach Gabrielas Haus, dieser zieht sich seine Jacke über und lässt seinen einzigen Gast alleine an der Bar sitzen. Mit mir im Schlepptau überquert er ein paar zum See gelegene Terrassen und dann stehen wir vor Gabriela. Eine Frau Mitte 40. Mit ihrer umgebundenen Kochschürze sieht sie aus, als würde sie den ganzen Tag nichts anderes tun, als in der Küche stehen und kochen. Das verheisst Gutes.


Gebratener Fisch bei Gabriela.
Jetzt sitze ich hier in einer kleinen Holzlaube, blicke durch das Panoramafenster auf den See und lasse mir die Nachmittagssonne ins Gesicht scheinen während ich auf meine gebratene Forelle warte. Der einfache Fisch mit Pommes, Salat und traditioneller Knoblauchpaste ist vielleicht kein Meisterwerk der Kochkunst, aber das Ambiente in der kleinen Stube ist einmalig. An der hinteren Wand hängen alte Familienfotos: eine fischende Männertruppe im Kahn, im See plantschende Kinder, ein Grossvater mit Seemannsmütze, der verschmitzt in die Kamera blinzelt. Dazwischen reihen sich Treibhölzer, alte Netze und geflochtene Taue. Ich könnte hier noch ewig sitzen bleiben und den Wellen auf dem See zugucken, aber ich habe immer noch nichts von der Altstadt gesehen.
Gabriela schickt mich zu der Kirche Sveti Jovan Kaneo (dem heiligen Johannes von Kaneo). Schon von weitem ein Postkartenpanorama: die Kirche Sv. Jovan Kaneo thront auf einem Felsvorsprung über dem See. An der Kirche vorbei schlängelt sich ein kleiner Pfad den Berg hoch und da ist er, der vielleicht berühmteste Ausblick über den Ohridsee. Der Ausblick, der einen von jedem Reiseführer, jeder Webseite und aus jedem Fotoalbum anspringt: die Sicht runter auf die Kirche mit dem See und den Bergen im Hintergrund. Obwohl schon so oft fotografiert, bleibt es einer der magischsten Aussichten, die ich in Europa je gesehen habe.

Die Kirche Sv. Jovan Kaneo.
Die Kirche selbst ist nicht gross; der Grundriss hat die Form eines Kreuzes, fast quadratisch. Im Inneren gibt es genau einen Saal, ausgestattet mit Fresken aus dem 13. Jahrhundert. Kirchen aus dem Mittelalter, davon hat Ohrid viele. Der Ort wird auch das Jerusalem des Balkans genannt, denn in der ganzen Gemeinde gibt es 366 christliche Gotteshäuser; eins für jeden Tag des Jahres (oft liest man nur von 365 Kirchen, aber die Einheimischen sind sich einig: es gibt auch eins für das Schaltjahr). Heute sind davon allerdings nur noch etwa 14 wirklich aktiv. Die Steinfassaden der Kirchen sind beeindruckend. Mit einer unglaublichen Präzision und Liebe müssen die Handwerker damals die Steine zusammen gefügt haben; nur anhand verschiedener Steinfarben ergeben sich Muster und Ornamente. Fast schon orientalisch.

In der Sophienkirche finden sich Fresken aus dem Mittelalter.
Dazu hat jede Kirche eine ganz eigene Legende oder Anekdote zu erzählen. Die merkwürdigste Geschichte: Nach der Eroberung Ohrids durch das Osmanische Reich war die Sophienkirche zwischenzeitlich mal eine Moschee. Bei den Umbauarbeiten tünchten die Osmanen die mittelalterlichen Wandmalereien über. Und wurden vergessen. Erst bei Renovierungsarbeiten in den 50er Jahren entdeckten die Restaurateure die bunten, byzantinischen Fresken wieder. Heute stellen sie eines der bedeutendsten Werke der Kunstgeschichte dar.
Die historische Altstadt ist voll von Sehenswürdigkeiten: die älteste slawische Universität Plaosnik, die Festung des Zaren Samuil, das hellenistische Amphitheater und, und, und. Während ich die am Hang gelegene Altstadt immer wieder auf und ab gehe, um ja nichts zu übersehen und ja keine Gasse unentdeckt zu lassen, verstehe ich, warum die Stadt Ohrid heisst. Eine Legende besagt, als damals das Militär unter König Samuil bei seinen Märschen ächzte, vermachten die Soldaten der Stadt ihren Namen: „Rid“ heisst auf Mazedonisch Berg. „Oh“ klagten die Soldaten, wenn sie mehrmals am Tag die Hügel hoch und runter marschierten. „Oh-Rid“ bedeutetalso nichts weiter als „Oh-Berg“. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wann es am Fusse des Berges – dem neueren Teil der Stadt – zu entdecken gibt.

Plaosnik ist die älteste Universität der slawischen Sprache. Ihre Ruinen werden gerade ausgegraben.

Das Amphitheater und die Festung des Zaren Samuil im Hintergrund.
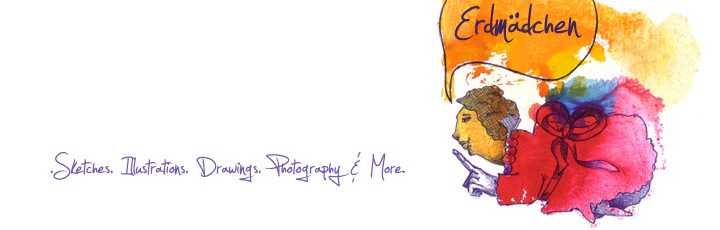



 Ich schreibe und ich reise. Mal bin ich ganz weit weg, mal erkunde ich meine Stadt oder nur meinen Block, manchmal reise ich durch mein Zimmer. Dazu gibt es meistens Zeichnungen aus meinem Sketchbook. Auch mal Fotos. Und vielleicht bringe ich von der ein oder anderen Reise auch ein leckeres Rezept mit. Hier findest du all meine Erinnerungen. Schön, dass du vorbei schaust!
Ich schreibe und ich reise. Mal bin ich ganz weit weg, mal erkunde ich meine Stadt oder nur meinen Block, manchmal reise ich durch mein Zimmer. Dazu gibt es meistens Zeichnungen aus meinem Sketchbook. Auch mal Fotos. Und vielleicht bringe ich von der ein oder anderen Reise auch ein leckeres Rezept mit. Hier findest du all meine Erinnerungen. Schön, dass du vorbei schaust!